Das Anliegen des Bandes ist es, Sozialarbeiter:innen und Personen in verwandten Berufen Anstöße zur Reflexion über die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, in der diese Arbeit stattfindet, zu geben.
Heinz Steinert (1942 – 2011) ist ein Sozialwissenschafter, seine Karriere begann in Wien. Nach dem Studium der Psychologie und der Ausbildung zum Psychoanalytiker begann er als Bewährungshelfer zu arbeiten. Er wechselte bald in die Wissenschaft und interessierte sich vermehrt für Soziologie. Er war Mitbegründer des Instituts für Rechts und Kriminalsoziologie, später wechselte er zur Goethe-Universität in Frankfurt.
Mehr Gerechtigkeit
Steinert sieht das Agieren der Justiz im Bereich des Geschehens rund um kriminelle Vorfälle sehr kritisch, nämlich als Ausdruck von Herrschaft. An den Problemen der in diese Vorfälle verwickelten Menschen arbeitet sie vorbei.
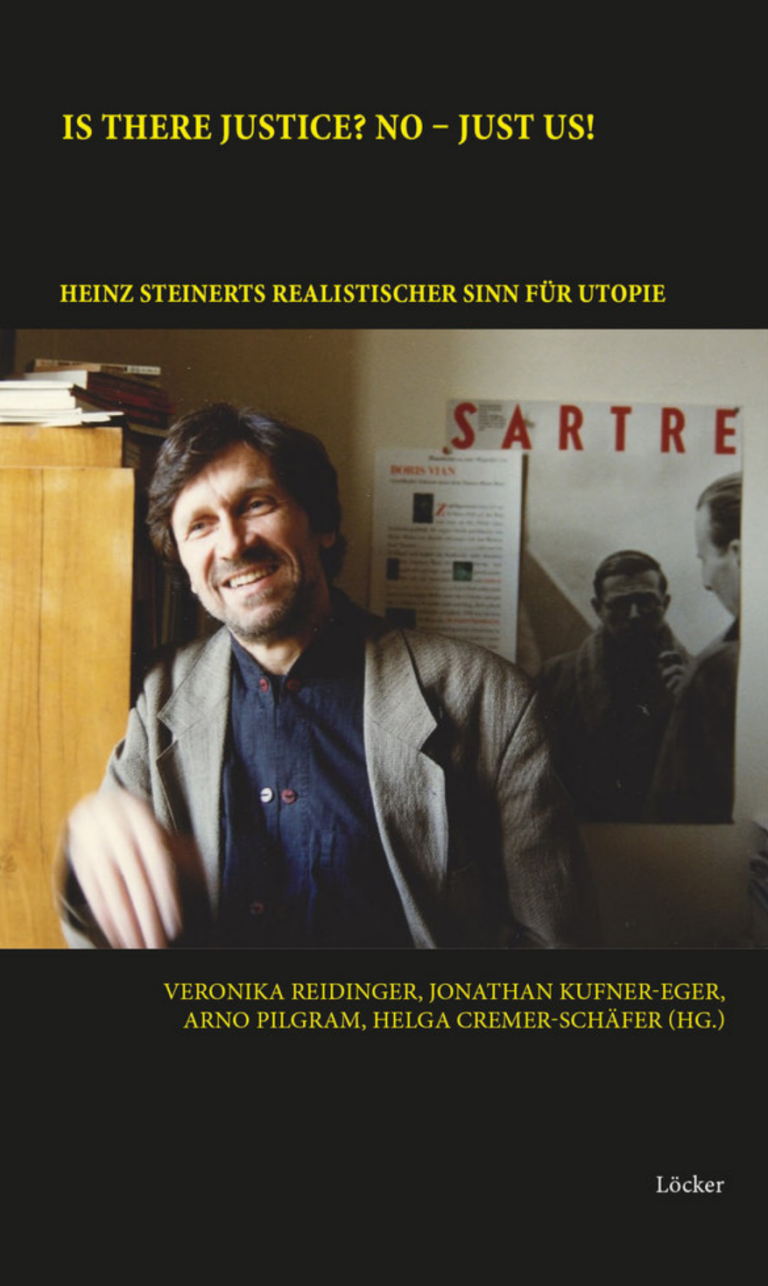
Die von den Herausgeber:innen gewählten Texte sind Arbeiten zum Umgang mit den (von Steinert so bezeichneten) Systemen „Verbrechen & Strafe“ und „Schwäche & Fürsorge“. Der Titel des Bandes ist auch der Titel eines dieser Texte. Steinert hat diesen Slogan auf der Brooklyn-Brücke in New York gefunden, wie er zu Beginn gleich erzählt. Dieser Slogan ist schillernd, vielleicht wurde er deswegen als Titel gewählt.
Steinert sieht das Agieren der Justiz im Bereich des Geschehens rund um kriminelle Vorfälle sehr kritisch, nämlich als Ausdruck von Herrschaft. An den Problemen der in diese Vorfälle verwickelten Menschen arbeitet sie vorbei. Wenn es aber um Gerechtigkeit geht (und das ist in diesem Slogan wohl die stimmigere Übersetzung des Wortes „justice“) wird das Bild diffuser, es scheint, als habe Steinert manchmal „Gerechtigkeit“ selbst im Verdacht, Ideologie zu sein. An anderen Stellen aber interessiert er sich doch für Versuche, die Reaktion auf Kriminalität so zu gestalten, dass sie den Beteiligten gerecht wird und zu mehr Gerechtigkeit führt.
Die Auswahl und die von den Herausgeber:innen vorgenommenen Kürzungen der Texte lassen die Lektüre von Steinerts Texten zu einer überschaubaren Angelegenheit werden. Auf etwa 200 Seiten inklusive Biografie und Einführung durch die Herausgeber:innen erhält man einen Grundkurs zum Steinertschen „Denkwerkzeug“.
Es eignet sich hervorragend zur Klärung der eigenen Gedanken und Haltungen und betrifft alle Tätigkeiten im Feld der Sozialarbeit für Polizei und Justiz, aber auch für die Arbeit mit Opfern und im Präventionsbereich. Der politische Gehalt dieser Aktivitäten und der ideengeschichtliche Hintergrund werden ausführlich zur Diskussion gestellt. Die Texte sind chronologisch geordnet, wodurch man auch die Veränderungen im Denken Steinerts mitbekommt. Beim Lesen kann man aber getrost hin und her springen, jeder Text steht für sich.
Soziale Unterstützung bei Problemlösung
Heinz Steinert war wohl schon zur Zeit seiner Tätigkeit im „Verein für Bewährungshilfe und soziale Jugendarbeit“ (heute NEUSTART) getrieben von der Utopie einer Gesellschaft in der die Reaktion auf Kriminalität so gestaltet ist, dass das Gefängnis keine wesentliche Rolle mehr darin spielt und „Strafe“ auf seine Folgen hin untersucht und durch soziale Unterstützung bei der Problemlösung ersetzbar wird.
Wie das konkret umzusetzen wäre, darüber erfahren wir bei ihm wenig, es ist ihm vielmehr ein Anliegen die Macht- und Herrschaftsmechanismen bloßzulegen, die sich hinter dem Strafen und dem polizeilichen Agieren verbergen, um solchermaßen den Weg für Alternativen freizumachen. Seine Forschung steht in der Tradition des Labelling Approachs, auch wenn er immer wieder über diesen hinausdenkt. Sein Denken kreist um die Etikettierung von Menschen als Außenseiter/ Auszustoßende und deren Folgen.
Das Wort „Utopie“ kommt in den früheren Aufsätzen noch prominent vor, ebenso die „gefängnislose Gesellschaft“, später aber wird auch zum Utopiebegriff eine gewisse Distanz spürbar, möglicherweise ähnlich wie bei Foucault, der die Utopien als eine ständige Begleitmusik zum Gefängnis sieht, die nie in die Praxis eingreift. Dabei ist Steinert nicht dogmatisch, immer wieder geht es darum, weniger Herrschaft möglich zu machen oder Leid zu verringern, wenn schon keine gänzliche Abkehr von Herrschafts-Zugriffen möglich ist. Dafür verwendet er den Begriff „Herrschaftsarmut“ als (vielleicht vorläufiges) Ziel, was auf eigenwillige Weise poetisch klingt.
Verbrechen & Strafe
Diejenige Reaktion auf Kriminalität, die Härte predigt, Gefängnis oder Schlimmeres will und dabei weder den Opfern hilft (ihnen oft sogar schadet), noch die Täter:innen zur Reflexion ihrer Verhaltensmuster bewegt (fast immer ist das genaue Gegenteil der Fall, wie jeder weiß, der mit Gefängnissen zu tun hat) ist das Ziel seiner Kritik.
„The eye of the law sits in the face of the ruling class“ zitiert Steinert Ernst Bloch.
Wenn aber die Reaktion auf Kriminalität durch Strafe ihre Ziele nicht erreicht, wieso sollte man dann die Polizei oder die Justiz überhaupt herbeiholen, wenn etwas passiert ist? So fragt Steinert immer wieder und verweist darauf, dass die Bevölkerung das genauso zu sehen scheint: man holt die Polizei, weil man die Registrierung des Vorfalls braucht, um Versicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen oder weil man in einer Situation ist, in der Gewalt durch einen „Störenfried“ droht und man staatlichen Eingriff benötigt um Ruhe zu haben. In vielen Fällen wird von den Leuten ohnehin eine andere Lösung des Problems gefunden und der Staat gar nicht gerufen, das lässt sich aus der hohen Dunkelziffer ableiten.
Wenn der Staat gerufen wurde, so sieht er die Chance, seine Herrschaftsansprüche geltend zu machen und sie hinter einem scheinbaren „Service“ zu verbergen. Das Service aber funktioniert nicht, die Muster der Herrschaft werden sichtbar, wenn beobachtet wird, dass fast ausschließlich für die besser gestellten Mitglieder der Gesellschaft eingeschritten wird und gegen schlechter gestellte.
„The eye of the law sits in the face of the ruling class“ zitiert Steinert Ernst Bloch. Auch das Ergebnis des Einschreitens führt zur Beschädigung aller Beteiligten. Dass das Strafrecht etwas für uns leistet, ist ein Mythos. Dies zu belegen hält Steinert für den Beginn eines emanzipatorischen Einsatzes gegen die Täuschung, die von der Herrschaft lanciert wird, weswegen er den drastischen Begriff des in Kauf genommenen „Menschenopfers“ verwendet um die Wirkungen der Aktionen des Systems „Verbrechen & Strafe“ zu charakterisieren.
Nach dem Einschreiten dieses Apparats sind die Probleme der Menschen weiterhin ungelöst, es wurde sogar zusätzliches Leid zugefügt. Vielfach haben sie sich dann sozialen Probleme aller, also auch der Opfer oder sonst Betroffenen verschärft. Staatliches Strafen könnte sich aber nur legitimieren, wenn es beweist, dass es etwas hilft. Genau das tut es aber nicht! Es entfaltet sein Wirken durch die Zufügung von Schmerz gegenüber Mitgliedern der Gesellschaft, die ohnehin schon benachteiligt sind, eine Zurschaustellung von Herrschaft mit keinem Nutzen darüber hinaus.
Für die Sensibilisierung gegen die Mythen, die im Bereich „Verbrechen & Strafe“ ständig produziert werden, also gegen die Verschleierung dessen, was wirklich geschieht, bietet dieser Band eine Menge weiterer Anregungen, um nicht zu sagen Provokationen.
Manchmal ist der polemische Ton der Sache ein wenig abträglich. Es wird so getan als wäre es nur dumm und machtbesessen, wenn jemand solchen „Mythen“ verfällt.
Interessant wäre, warum sich gerade diese Mythen zur Verschleierung so gut eignen, wieso wir alle immer wieder versucht sind, dem Irrtum vom Nutzen der Strafe aufzusitzen und wieso wir alle so emotionalisierbar sind durch Kriminalität. Aber diesen Fragen wird leider nicht nachgegangen, obwohl einige Überlegungen an anderen Stellen bei Steinert, nämlich denen zur Kulturindustrie, nahe an dieses Thema herankommen. Sieht man aber von diesem distanziert-polemischen Gestus ab, gibt es viel zu holen bei diesen Texten und egal ob der:die Leser:in zustimmt oder widerspricht, die Reflexion dieser Sachverhalte wird jedenfalls vorangetrieben.
Schwäche & Fürsorge
Genau das verlangt Sensibilität und Skepsis gegen das (vielfach unbegründete) Vertrauen, der Apparat von „Verbrechen & Strafe“ sei auf der Seite der „Guten“ die das „Böse“ bekämpfen.
Nun aber zum zweiten wichtigen Bereich, der die Sozialarbeit noch konkreter betrifft: das System „Schwäche & Fürsorge“. Auch dieses System wird immer wieder kritisch betrachtet, entweder als Ordnungsmacht im Vorfeld des Systems „Verbrechen & Strafen“ oder als Etikettierungsinstanz, die mit Desorganisations- oder Defizitbegriffen arbeitet. Diese Etikette degradieren, das Klientel wird als gefährlich, und nicht selten damit implizit als minderwertig oder gemeinschaftsfremd definiert.
Diese Begriffe sind nicht zufällig auch im nationalsozialistischen Jargon gebraucht worden, um Ausschlussverfahren zu legitimieren. Die Sensibilisierung für diese Vorgänge ist dringlich. Immer wieder genügt der Begriff „Gefährder:in“ um Verfahren der Etikettierung und Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, obwohl noch keine Schuld erwiesen ist, ja obwohl oft nicht einmal ein diesbezügliches Verfahren eingeleitet wurde. Die Assoziation zur NS–Zeit ist nicht willkürlich. Wie in den Forschungen zu den mit dem „grünen Winkel“ im KZ Mauthausen untergebrachten „Berufsverbrechern“ gezeigt wird (siehe etwa Andreas Kranebitter: Die Konstruktion von Kriminellen. Die Inhaftierung von Berufsverbrechern im KZ Mauthausen. Wien 2024, S. 22f), handelte es sich überwiegend um Personen die keinerlei bewiesene Schuld auf sich geladen hatten, sondern um Personen, die der Polizei im Rahmen der „Prävention“ aufgefallen sind, und im Verdacht waren, „Volksschädlinge“ zu sein.
Führt man sich diese Untaten vor Augen wird man besonders sensibilisiert für den Umgang mit Personen, die noch nicht schuldig gesprochen wurden. Gleichzeitig ist es in der sozialen Arbeit schon verständlich, dass man „präventiv“ auf Auffälligkeiten reagieren will, bevor es zu Straftaten kommt. Genau das verlangt Sensibilität und Skepsis gegen das (vielfach unbegründete) Vertrauen, der Apparat von „Verbrechen & Strafe“ sei auf der Seite der „Guten“ die das „Böse“ bekämpfen.
Die Zuschreibungen von Defiziten durch das System „Schwäche & Fürsorge“ bleiben aktenkundig und auch wenn diese Fakten derzeit üblicherweise nicht zum Schaden der Betroffenen verwendet werden, so braucht es nur geringfügige Änderungen im Funktionieren der Herrschaft um die so erfassten Personen der sozialen Ausschließung auszusetzen. Dies ist eine offenkundig gefährliche Seite der Allianz der Institutionen „Schwäche & Fürsorge“ und „Verbrechen & Strafe“.
Die weniger offenkundige ist die gemeinsame Produktion von Feindbildern und Mythen, zum Beispiel dem des „gefährlichen Drogendealers“, wenn ein Jugendlicher mit Cannabis aufgegriffen wird, oder auch die Verharmlosung von staatlichem Zugriff, wenn in der Bewährungshilfe der Zwangskontext hinter einem „das tut dem Klienten doch nur gut, wenn wir uns kümmern“ verschleiert wird. Jegliche vom Staat ausgesprochene Verpflichtung ist eine Etikettierung und eine Drohung, ins andere System weitergeleitet zu werden. Mit etwas Glück bleibt es dabei, dass die Probezeit vorbeigeht, aber auch dann gibt es die Registrierung. Die Zugänglichkeit des Registers durch die diversen Stellen des Machtapparats ist allen Betroffenen auf mehr oder weniger diffuse Weise klar und sie hat Folgen im Alltag.
Fazit
Der Band ist ausgewogen gestaltet, ein kurzer englischsprachiger Text stört den Gesamteindruck nicht, einerseits, weil es ein guter Text ist, andererseits, weil Leser:innen, die diesen Text übergehen, die wesentlichen Steinertschen Denkfiguren in den anderen Beiträgen trotzdem mitbekommen. Die Argumentationen wiederholen sich generell einige Male, stehen aber immer wieder in ein wenig anderen Kontexten. Dazu kommen wirklich nette graphische Auflockerungen, auch eine Karikatur einer Studentin, die Steinert beim Vortrag eingefangen hatte, ist dabei. Das Titelbild zeigt Steinert vor einem Poster mit Jean-Paul Sartre, deswegen hier ein passender Satz von diesem, obwohl ich nicht sicher bin, ob Steinert ihm zugestimmt hätte. Sartre hat ein Buch über den wiederholt zu Freiheitsstrafen verurteilten Dichter Jean Genet verfasst in dem folgender Satz steht:
Wichtig ist nicht was man aus uns macht, sondern, was wir aus dem machen, was man aus uns gemacht hat.



